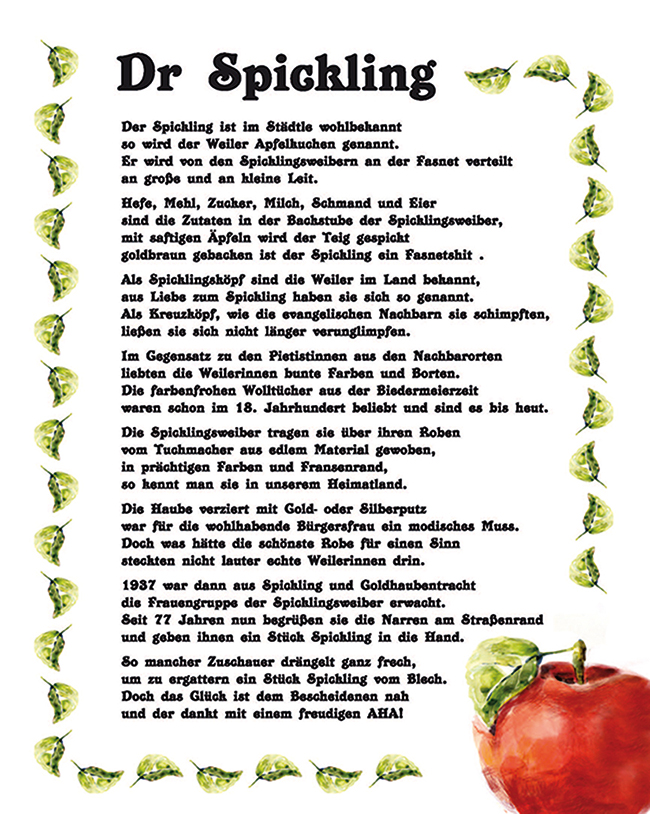Geschichte
Der Spickling
Verfasser: Wolfgang Schütz
1. Etymologie des Wortes: "Spicken" dürfte hier der Bedeutung " reichlich ausstatten mit etwas" entsprechen. "Spicken" ist von "Speck" abgeleitet, mit dem man z. B. einen Braten durchzieht, damit er saftig wird. Das ursprüngliche "Spickmaterial" Speck ist dabei nicht mehr wichtig, sondern nur die Tätigkeit des Hineinsteckens.
2. Geschichte des Kuchens: Das Wort "Spickling" scheint eine lokale Weil der Städter Wortschöpfung zu sein. In den schwäbischen Wörterbüchern fehlt es jedenfalls. Den ältesten Beleg dafür habe ich im Ratsprotokoll von 1781, S. 671, gefunden. Dort heißt es: "An der Möttlinger Kirchweih am Sonntag seyen bey 50 Spickling verbraucht worden." Damals hatte Weil der Stadt noch Grundbesitz in Möttlingen; der "Meierhof" mitten im Dorf und das dortige Weil der Städter Reichsadler-Wappen, das auch an der Chordecke der Kirche prangt, zeugen heute noch davon.
Warum gerade der Spickling zu einem Weil der Städter "Alleinstellungsmerkmal" wurde, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Eine Vorraussetzung ist der Obstbau. Allerdings liegt darüber noch keine Untersuchung vor. Nachdem Weil 1802 württembergisch geworden war, wurde vom Staat die Pflanzung von Obstbäumen entlang der Landstraßen angeordnet. Der ehemalige Senator Josef Anton Reeble führte die Pflanzung durch. Der Einfluss der landeseigenen Baumschulen auf der Soletude (unter der Leitung von Johann Caspar Schiller, dem Vater des Dichters) und an der neugegründeten landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim wirkte sich auch in Weil der Stadt aus. Obstbäume wurden häufig auch in ehemaligen Weinbergen angepflanzt. Obst war eine zusätzliche Nahrungsquelle (Dörrobst, Most, Obstbranntwein - und Spicklinge). Offensichtlich spielte der Apfel als Nahrungsmittel hier eine wichtige Rolle. Dafür sprechen auch die 50 Kirchweih-Spicklinge von 1781!

Die Weiber
Kleidung der "Spicklingsweiber": Die traditionelle Kleidung der wohlhabenderen Bürgersfrauen mit Gold-bzw. Silberhaube und Biedermeier-Kaschmirschal war noch in einigen Exemplaren ins 20. Jahrhundert herübergerettet worden. Im Stadtmuseum haben wir noch ein paar alte Gold- bzw. Silberhauben. Diese Hauben waren in den süddeutschen Städten in vielen Varianten verbreitet.
Schon auf Portraits des späten 18. Jahrhunderts werden sie zum Beispiel von der Frau des Bürgermeisters Johann Baptist Gall getragen. Die Hauben wurden um 1800 von den Töchtern des Schneiders Jakob Preisle angefertigt, die "auf dem Plan" gleich neben dem Storchenturm wohnten. Das "Universallexikon von Württemberg" stellte noch 1834 fest, dass die Weilerinnen im Gegensatz zu den Frauen der pietistisch geprägten Nachbarorten in ihrer Tracht die bunten Farben liebten. Nach dem Ende der Biedermeier-Zeit (nach 1848) kam diese Kleidung allmählich aus der Mode. Bestimmt wurden aber die schönen Stücke von älteren Damen noch darüber hinaus "aufgetragen".
Als das historische Bewusstsein im Laufe des 19. Jahrhunderts in breiteren Bevölkerungskreisen wuchs und man begann, die alte Zeit nostalgisch "nachzuspielen", besann man sich auch auf die alte Frauentracht und trat zuweilen seit den 1920er Jahren öffentlich damit auf. Besonders im Umfeld des Keplerjubiläums 1930, als man auch in Weil das zarte Pflänzchen "Tourismus" zu pflegen begann, setzte die Stadtverwaltung zuweilen zwei Paare in nachgeschneideter Bürgertracht zum Empfang von auswärtigen Besuchern am Bahnhof ein.
Am Fasnachtsumzug von 1937 nahm dann zum ersten Mal eine Frauengruppe als Spicklingsweiber teil. Das heißt: Irgendjemand (vielleicht der Umzugserfinder Heinrich Pflaum oder doch wohl eher eine pfiffige Frau!) hatte die Idee, die beiden Traditionsstränge "Goldhaubentracht" und "Spickling" miteinander zu verflechten.

So entstand die Fasnet
Die ersten Zeugnisse der Weil der Städter Fasnet reichen fast bis ins Mittelalter zurück. Meist bestehen sie aber aus Verboten und Strafen, wenn es einer mal übertrieben hat. Eine richtige organisierte Fasnet mit gleichartigen Masken und einem Häs, wie in Rottweil oder Elzach, gab es in Weil der Stadt lange Zeit nicht.
Erst während der Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert organisierten sich Gruppen und führten Schauspiele auf dem Marktplatz auf. In dieser Zeit trat auch die Zigeunergruppe das erste Mal in Erscheinung.
Erst die Gründung der Narrenzunft Weil der Stadt e.V. brachte Kontinuität in das närrische Treiben.
So entstanden zunächst neben der Zigeunergruppe im Jahre 1957 die Weiler Hexen mit ihren grausligen Gesichtern.
Heute besteht die Narrenzunft aus den Maskengruppen: Bären, Hexen, Schellenteufel, Schelme, Schlehengeister, Steckentäler und den Gruppen: AHA-Ballett, Clowns, Narrenkapelle, Siebenerrat, Spicklingsweiber, Zigeuner.
So läuft die Fasnetssaison ab
Die Saison beginnt am 11.11. mit einem kleinen Umzug vom Spital zum Marktplatz. Eine Woche vor dem Fasnetssonntag findet der Narrensprung mit dem Rathaussturm statt. Der Bürgermeister wird aus dem Rathaus vertrieben und übergibt die Macht - symbolisch durch den überdimensionalen Rathausschlüssel - an den Zunftmeister.
Am Fasnetssonntag strömen inzwischen mehrere zehntausend Gäste nach Weil der Stadt, um den großen Umzug anzuschauen.
Seine Besonderheit ist die Mischung aus imposanten Wagen, Maskengruppen und Musikkapellen. Er führt um den gesamten historischen Stadtkern und gehört zu den längsten Umzügen überhaupt.
Damit aber nicht genug, am Fasnetsdienstag sind die Kleinen dran. Ein Kinderumzug begeistert die Kids, sie dürfen in den Wagen der "Großen" mitfahren.
Die Fasnetsverbrennung pünktlich um 24.00 Uhr beendet die Fasnetssaison.